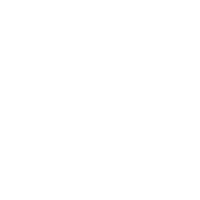Nachrichten
Für eine neue Sachlichkeit - Zum Umgang mit der Person Pater Kentenichs

Pater Josef Kentenich mit Familien in Milwaukee, USA (Foto: Archiv)
Hubertus Brantzen. Seit dem Erscheinen des Buches „Vater darf das!“ von Alexandra von Teuffenbach über Pater Josef Kentenich ist der Gründer der Schönstatt-Bewegung ins Zwielicht geraten. Das Problematische an diesem Vorgang ist, dass ein Vorwurf oder eine Verdächtigung wegen Missbrauchs, einmal in die Welt gesetzt, nicht mehr zurückgenommen werden kann. In der gesellschaftlichen und kirchlichen Großwetterlage mit immer neuen diözesanen und überregionalen Enthüllungen kommt der von Teuffenbach formulierte Vorwurf, wie in einem Brennglas verstärkt, als besonderer Skandal in der Öffentlichkeit an. Ob der Vorwurf der Realität entspricht, spielt dabei kaum eine Rolle. Von Medium zu Medium wird der Skandal als Wirklichkeit weitergereicht – und das rund um den Globus.

Im Zeitraum 2021 bis 2023 sind zunächst die folgenden Bände erschienen:
- Studienausgabe 1: Berichte der Bischöflichen und Apostolischen Visitationen 1949 bis 1953
- Studienausgabe 2: Korrespondenz und Ansprachen zur Bischöflichen Visitation 1949
- Studienausgabe 3 in drei Teilbänden:
Auseinandersetzung mit dem Heiligen Offizium – Der Briefverkehr zwischen Pater Kentenich und Generalrektor Turowski SAC

Im April und Mai 2024 ist rechtzeitig zum 50. Jubiläum des 31. Mai 1949 im Patris Varlag die Epistola Perlonga erschienen:
- Studienausgabe 5 in zwei Teilbänden:
Epistola perlonga – Pater Kentenichs Antwortschreiben auf den Bericht der Bischöflichen Visitation 1949. Historisch-kritische Ausgabe, editiert, eingeleitet und kommentiert von Manfred Gerwing und Joachim Söder
Inzwischen hat sich ein nüchterner Umgang mit der Anklage eingestellt. Nachdem sich auf verschiedenen Ebenen Studien- und Forschungsgruppen gebildet haben, um Hintergründe und Kontexte der zitierten Dokumente zu bearbeiten, ergibt sich ein klareres Bild. Offenbar hat die Verfasserin willkürlich Dokumente ausgewählt und entsprechend interpretiert, die ihrer Meinung nach zur Grundannahme des Missbrauchs passen. Eine Betrachtung der zitierten Briefe in den entsprechenden Kontexten wird im Buch zwar angekündigt, aber kaum tatsächlich geliefert. Außerdem erweckt die Verfasserin den Anschein, Neues zutage zu fördern, während in Wirklichkeit, besonders im Rahmen des Seligsprechungskontextes, die Dokumente bereits bekannt waren und bearbeitet wurden. Weitere Forschungsarbeiten werden wohl ein noch differenzierteres Bild ergeben.
Neue Chancen
Wie der Postulator des Seligsprechnungsprozesses für Pater Kentenich, Pater Eduardo Aquirre, im ersten Heft von „basis“ in diesem Jahr beschreibt, werden inzwischen neue Chancen und Impulse in dieser Situation deutlich. Zwar kann der Vorwurf des Missbrauchs nicht aus der Öffentlichkeit zurückgeholt werden. Auch sollen die Vorwürfe nicht einfach abgetan, sondern konsequent überprüft werden. Doch können nun andere Aspekte im Vordergrund stehen, die bisher in ihrer Bedeutung zu wenig oder nicht in ihrer Tragweite beachtet wurden. Einige solcher Aspekte seien hier vorgestellt.
Freie Forschung über Pater Kentenich
Mit der Aussetzung – nicht etwa der Beendigung – des Seligsprechungsprozesses durch den Trierer Bischof Stephan Ackermann sind Forschungen über die Geschichte der Schönstatt-Bewegung und das Leben Pater Kentenichs in ein neues Stadium getreten. Bischof Ackermann hat mit jenem Schritt zugleich aufgefordert, weitergehende Studien einzuleiten. Wenn neue Erkenntnisse vorliegen, kann das Verfahren zur Seligsprechung fortgesetzt werden.
Das hat vielfältige Kräfte freigesetzt. Innerhalb der Bewegung entstehen zum Beispiel Studienausgaben, in denen wichtige Dokumente der Geschichte der Schönstatt-Bewegung präsentiert werden. So werfen beispielsweise die drei Teilbände zur Auseinandersetzung Pater Kentenichs mit dem Heiligen Offizium in Rom ein Licht darauf, was die eigentlichen Beweggründe der kirchlichen Behörden waren, Pater Kentenich ins Exil zu schicken. In einer freien Forschung braucht nun nicht mehr Zurückhaltung gegenüber den Verfahren der bischöflichen und römischen Behörden geübt, sondern kann klar über Verhaltensweisen und Machtansprüche der kirchlichen Oberen gesprochen werden.

Pater Josef Kentenich nach seiner Rückkehr aus dem kirchlichen Exil in Milwaukee bei einem Vortrag in der Aula der Schönstätter Marienschule, Vallendar (Foto: Archiv)
Den Blick auf die Kirche und deren Umgang mit den Menschen aushalten
In den Dokumenten der Vergangenheit wird deutlich, wie die Kirche in früheren Zeiten mit exponierten Menschen umging, nicht etwa nur mit Pater Kentenich. So zeigen viele Dokumente einen Missbrauch ganz anderer Art, nämlich einen ausgesprochenen Machtmissbrauch der kirchlichen Leitungsebenen, der aus heutigem Lebensgefühl kaum mehr zu verstehen ist. Wenn aus den Dekreten aus Rom gegen Pater Kentenich in den 1950er Jahren klar hervorgeht, dass in extremer Form ein Kadavergehorsam ohne Protest und Nachfrage der Betroffenen gefordert wird, ist das für den heutigen Leser nur befremdlich. Wenn von einem Bischof festgestellt wird, dem Heiligen Offizium in Rom dürfe man sich nur auf Knien nähern, kann man nur den Kopf schütteln. Wenn in dem besagten Zeitraum die Bewegungsfreiheit Pater Kentenichs in seinem Exil in Milwaukee per Dekret immer mehr eingeschränkt und bestimmt wird, mit wem er Kontakt pflegen und welche Orte er besuchen dürfe und welche nicht, so reibt sich der heutige Leser die Augen und fragt sich, ob das nicht pure Menschenverachtung ist. Wenn man daneben feststellt, dass Pater Kentenich wünschte, dass auf seinem Grab die Worte „Dilexit ecclesiam“ – „Er liebte die Kirche“ stehen sollen, kommt man als heutiges Kirchenmitglied ins Grübeln.
Geschichte der Schönstatt-Bewegung besser kennenlernen
Ziel, sich mit Dokumenten aus der Vergangenheit zu beschäftigen, ist, sich vertieft mit der Geschichte der Schönstatt-Bewegung zu befassen. So wie Menschen und soziale Gebilde wie die Schönstatt-Bewegung heute gesehen werden, haben sie ihre Wurzeln und werden verständlich aus den Erfahrungen der Vergangenheit. Das Studium der Vergangenheit gibt Aufschluss über die Gegenwart. So zeigt sich beispielsweise, dass die Bezeichnung Pater Kentenichs als Gründer der Schönstatt-Bewegung durchaus nicht immer unumstritten war. In den 1940er und 1950er Jahren gab es einen teilweise erbitterten Kampf unter den Pallottinern, ob Schönstatt eine eigenständige Gründung oder nur eine Ausformung der Gründung Vinzenz Pallottis sei. Dieser Kampf traf die Bewegung und die Gemeinschaft der Pallottiner gleichermaßen, weil die Pallottiner als „pars motrix et centralis“ – als bewegender und zentraler Teil – der Bewegung verstanden wurden. Diese Auseinandersetzung ging so weit, dass sogar ein römisches Dekret verbot, Pater Kentenich als eigenständigen Gründer zu verstehen. Wunden, die in dieser Zeit geschlagen wurden, sind teilweise bis zum heutigen Tag nicht völlig geheilt.
Auf die eigentliche Sendung schauen
Nachdem die Kirche durch zwei Visitationen – die sogenannte „Kanonische Visitation“ durch den Trierer Weihbischof Bernhard Stein (1949) und die „Apostolische Visitation“ durch Jesuitenpater Sebastian Tromp (1951-1953) – die Schönstatt-Bewegung geprüft hatte, stellte Pater Kentenich fest, dass nur eher nebensächliche Fragen angesprochen worden seien. Das eigentliche Problem des sogenannten „organischen Denkens“ im Gegensatz zum „mechanistischen Denken“ sei gar nicht oder nur peripher zur Sprache gekommen. Pater Kentenich hatte diagnostiziert und in seiner „Epistola perlonga“, einem sehr langen Brief an Weihbischof Stein, ausgeführt, das größte Problem der Kirche und der Kultur überhaupt sei, dass Gott und Welt auseinandergerissen würden. Leben und Glauben, das Wirken Gottes in der Welt durch Menschen, Dinge und Ereignisse würden „mechanistisch“ getrennt und dadurch der Zugang zum Glauben an Gott und zu einer echten Gottesbeziehung versperrt. Vonseiten der kirchlichen Amtsträger wurde diese Diagnose als überzogen abgetan. Aus heutiger Perspektive hat damit Pater Kentenich jedoch genau das getroffen, was wir in der heutigen Kirche erfahren: Was nämlich den Glauben neu erstarken lassen könnte, sind nicht auch noch so wichtige strukturelle Erneuerungen, sondern eine lebendige, „organisch“ verknüpfte Welt- und Gottesbeziehung.
Neu entdecken, was Pater Kentenich für die Schönstatt-Bewegung bedeutet
Pater Kentenich selbst hat darauf verwiesen, dass Gott durch bedeutende, auch erschütternde Ereignisse in besonderer Weise aufmerksam auf das machen möchte, was gerade für die Kirche, Gesellschaft und für die Menschen allgemein wichtig sei. Auf seine Person angewandt kann das wohl bedeuten, seine Stellung in der Schönstatt-Bewegung neu zu erfassen: Wie sind Attribute wie „Vater“ und „Gründer“ zu verstehen? Ist seine Funktion weiterhin die eines Vaters in einer Bewegung, die sich selbst „Schönstatt-Familie“ nennt und als solche versteht? Schließlich werden sich die einzelnen Mitglieder der Bewegung ganz persönlich fragen müssen: Wer ist Pater Kentenich für mich? Was macht jener Vorwurf mit meinem persönlichen Verhältnis zu ihm? Wie abhängig mache ich mich in der Einschätzung seiner Person von dem, was auf diese fragwürdige Weise in der Öffentlichkeit über ihn verbreitet wurde? Wie schätze ich selbst jene Vorwürfe ein?