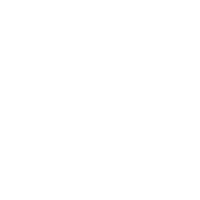Berufsziel Priester in der Mission – nicht Frauenseelsorger
Artikel 1 von 4 aus der Serie: Der Priester Josef Kentenich und die Frau
Es wäre dem jungen Schüler Josef in Ehrenbreitstein nie in den Sinn gekommen, sich konkrete Gedanken darüber zu machen, was er als Priester einmal mit Frauen zu tun haben könnte. Bisher kannte er außer seiner Mutter und der Cousine Henriette keine Frauen, die für ihn interessant sein konnten. Die wenigen Monate, die er als Sechsjähriger mit seiner Mutter beim Onkel in Straßburg verbrachte, waren beeindruckend. Viele neue Erfahrungen in dieser 150.000 Einwohner zählenden Welt- und Handelsstadt weiteten seinen Horizont.
Die Frauen dort blieben freilich weniger in seinem Gedächtnis als die große Hauben tragenden Schwestern, die ihn ab 1894 im Waisenhaus in Oberhausen betreut haben. Wirklich innerlich berührt und geprägt hat ihn - wie er selbst oft bezeugt - eine andere Frau, die Muttergottes. Beim Abschied von seiner leiblichen Mutter in der Waisenhauskapelle wurde sie seine neue Mutter und Begleiterin – freilich in einer anderen, inneren Dimension. Dieses Erlebnis am 12. April 1894 war für seine religiöse und persönliche Entwicklung ausschlaggebend und ein Kernerlebnis, das lebenslang Auswirkungen hatte.
Maria, eine Frau, die ihn geprägt hat
Doch erlebt er in Maria nicht primär eine Frau, sondern das, was ihm Gott auch künftig als barmherzig liebender Vater sein wird - eine Begleiterin in allen Lagen. Diese Erfahrung trägt durch schwere Jahre, in denen sein innerstes Berufsziel als unmöglich vor Augen stand. Er wollte Priester werden. Doch seine uneheliche Geburt schien das nicht zuzulassen. Eine neue Perspektive lockte, als er im Sommer 1899 mit dem Abschlusszeugnis von Oberhausen endlich ins Internat nach Ehrenbreitstein konnte. Die Missionsgesellschaft der Pallottiner bildete Priester als Missionare für Afrika aus. Dieser Weg schien offen. Jetzt kam er ins Gymnasium, dem ersten wichtigen Schritt für den ersehnten Priesterberuf.
Zu dieser Zeit war es ganz klar, dass keine Frauen als Gymnasiallehrerinnen Unterricht erteilten oder sonst eine prägende Rolle im Internat spielten. Seiner Mutter blieb er mit vielen sonntäglichen Briefen verbunden. Er spürte seine Vaterlosigkeit und das, was er in einem seiner Gedichte damals ausdrückte: „Dem mütterlich Lieben / Mit eisener Hand / Entrissen…“.
Die Verbindung zu seiner Mutter hielt auch die Jahre, die er nach dem Abitur in Ehrenbreitstein ab 1904 in Limburg als Novize und Student bei den Pallottinern zubrachte. Den jungen Novizen bedrängte im Lauf der Studienjahre persönlich vieles, aber auch Inhalte, die gelehrt wurden oder in der damaligen Zeit klare Lebensordnung für einen künftigen Priester waren. Dazu gehörten natürlich auch Regelungen, die „das andere Geschlecht“ betrafen. So war es unter vielen anderen Vorgaben klar, dass kein Priester vor seinem 35. Lebensjahr Formen von Frauenseelsorge übernehmen würde.
Endlich Priester – Spiritual für Jungen
Nach manchen äußeren und inneren Schwierigkeiten kam am 8. Juli 1910 der ersehnte Tag seiner Priesterweihe. Gottes Pläne wollten verstanden werden. Missionar in Afrika ging nicht, wegen seiner schlechten Gesundheit. Damit aber kam die Chance als Pädagoge zu wirken – Lehrer in Ehrenbreitstein und ab 1912 Spiritual im Studienheim in Schönstatt. Auch dort galt es, lediglich Jungen geistlich zu führen und zu erziehen. Für alles, was junge Menschen in einer Situation weg von zuhause erleben können, war er da, „eine Art Vater und Mutter gleichzeitig“ wie später über ihn gesagt wurde. Das blieb und war noch so, als dann der 18. Oktober 1914 kam. Der Vortrag bei den Jungen wurde zur Gründung einer neuen geistlichen Bewegung.
Viele Zeugnisse und manche Biografie über P. Kentenich zeigen auf, dass er einerseits ganz Kind seiner Zeit war, wissend um die geltenden Perspektiven und Verhaltensmuster. Andererseits brachten seine Gedanken und Anliegen auch schnell ganz unübliche Verhaltensweisen zutage - etwa als Pädagoge. Grund waren keine revolutionären Absichten, sondern sein Wertempfinden Menschen gegenüber und sein kritischer und gleichzeitig tiefer Glaube. Er rechnete stets damit, dass die Geschehnisse jeden Tages auch Botschaften Gottes waren. Solcher „Vorsehungsglaube“ ließ ihn offen sein für alles, was sich ereignete.
Frauen schließen sich an
Das zeigte sich auch, als es schon 1920 zur zunächst nicht beabsichtigten Mitarbeit von Frauen in der neu sich entfaltenden Bewegung kam. „Bundesschwestern“ wurden diejenigen genannt, die an sich selbst besondere Anforderungen gestellt hatten. Diese unterschieden sie von der Gruppe anderer Frauen, die „Ligistinnen“ genannt wurden. Die Zeitschrift „Mater ter admirabilis“ legte mit dem Dezemberheft des 11. Jahrgangs 1924 eine „Frauennummer“ vor. Eine Liste aus dem Jahr 1925 führt bereits über 500 verheiratete und ledige Frauen mit Beruf und Herkunftsort namentlich auf. Die Zahl der Frauen stieg schnell. Die Möglichkeit, sich als Person und speziell als Frau selbstständig weiter frei entfalten zu können, zog an. 1926 waren so viele Frauen bereit, sich ganz in den Dienst Schönstatts zu stellen, dass es zur Gründung der ersten eigenständigen Frauengemeinschaft in Schönstatt kam, den Marienschwestern.
Josef Kentenich beobachtete wach, was jetzt durch die Frauen eingebracht wurde. Er war offen für alles Leben, das sich zeigte. Aufschlussreiche Zeugnisse belegen, dass der Gründer mit vielen einzelnen vor allem brieflich Kontakt hielt. Dass es dabei nicht bleiben konnte, zeigt die weitere Entwicklung. Dabei geht es auch, aber nicht nur um Frauenseelsorge. Es ging um eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Sein priesterliches Tun im Umgang mit vielen unterschiedlichen Frauen, wurde wachsamer, offener und flexibler. Das Denken, die Einschätzungen und der Einsatz von Frauen zeigten andere Perspektiven. Dies machte neue Entwicklungen möglich, die Kentenich nie einfach abbremste. Vielmehr wollte und konnte er sich offen damit auseinandersetzen und darauf einlassen.
Beiträge zu einem umfassenderen Bild in der Causa Kentenich
In Kooperation verschiedener Personen aus der Schönstatt-Bewegung werden im Auftrag des Generalpräsidiums des internationalen Schönstattwerkes Themen bearbeitet, die Pater Josef Kentenich, den Gründer der Bewegung, betreffen und die derzeit angefragt sind. Dies geschieht aufgrund des jeweiligen aktuellen Kenntnisstandes, der sich aus den zugänglichen Dokumenten und Schriften ergibt. Die Ergebnisse der Forschungen und Gespräche sind jeweils in themenbezogenen Artikeln zu lesen. Ihre Vorschläge für Themen weiterer Artikel können Sie gerne senden an: mk@schoenstatt.de.
PressOffice Schoenstatt International
Zurück zum Übersicht der Artikelserie: Der Priester Josef Kentenich und die Frau